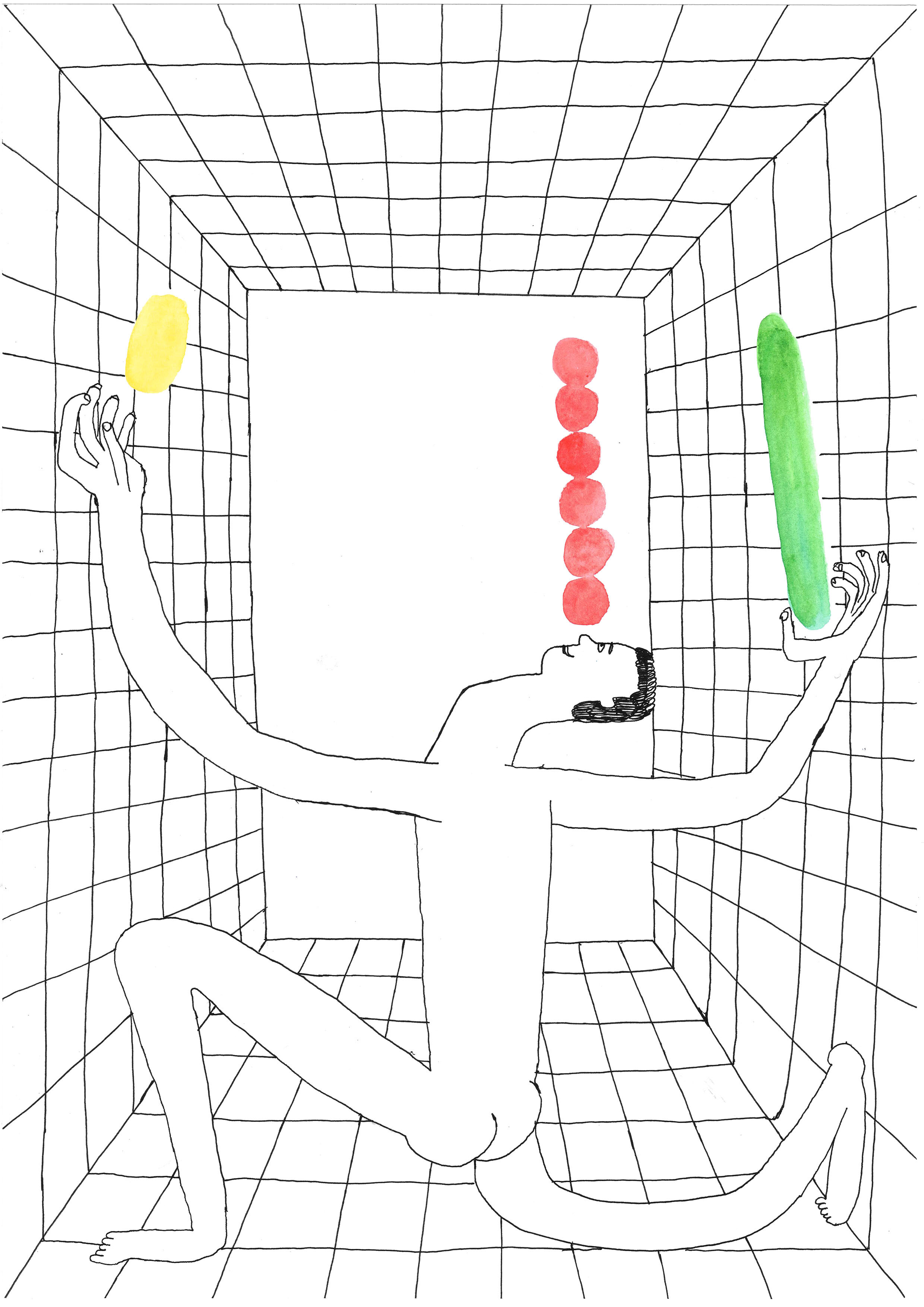The Olympics of challenging expectations
As I am writing this, the Olympic Games have concluded about a month ago. And yet, it still feels hard to grasp what to make of them: a spectacle without spectators, carried out in gigantic stadiums that felt eerily quiet. Without a doubt this was the most obvious reminder that these games were by no means “normal”, and they certainly lacked some of the excitement one is accustomed to whenever the Olympic flame gets lit and competitions begin.
Also, postponing the opening ceremony for a whole year didn’t change the fact that we witnessed the games of “Tokyo 2020” – apparently, the International Olympic Committee (IOC) wanted to keep 2020 around for a little longer. But in tune with the past one-and-a-half years that shaped its appearance, this edition of the Olympics brought up issues that had long been simmering beneath the surface. Like all of us, the athletes had to deal with the trappings of a global pandemic. They found a lot of empty space at the games – but also used it to further redefine what it means to be an athlete.
The evolution of athlete activism
First, after mounting pressure from various sides, the IOC loosened rule 50 of the Olympic Charter, which prohibited athletes from staging any visible protest or demonstration at the games – essentially stripping them of their right to express their opinion towards anything except sports competition.
Many made use of this newly found freedom: soccer players of different nations knelt before their games to protest structural racism; Shot-putter Raven Saunders as well as fencer Race Imboden flashed an “X” as a sign of the “intersection where all oppressed people meet”, as Saunders explained the symbol. Don’t get me wrong: political protest has always been a part of the Olympics. Most notably by black sprinters Tommie Smith and John Carlos who, while standing on the podium in 1968, bowed their heads and raised their fists to protest social injustice and racism in support of the civil rights group Black Panthers. Soon thereafter they were excluded from the rest of the games, as well as ostracized by the IOC for the duration of their lifetimes. That protest is not seen as breaking rules anymore is an important signal, even though the IOC is still far from being a boon of social justice (see for example: China Uighurs). At the very least, the longstanding notion of the athlete as a largely voiceless vessel for entertainment seems to have received another crack.
Not only this point showed an important change that came full circle at the Tokyo Olympics: athletes challenged the perception of what their place in society should be and how to interpret it for themselves. This is by no means a completely new development. Rather, it is the result of decades worth of dismantling a literally ancient understanding of the athlete as a warrior, who is ultimately only judged by the binary logic of glory or defeat. You read that correctly: even in ancient Greece, the straightest road to glory was the defeat of one’s opponent – or death. While this understanding of success (in a less archaic way) seems to have prevailed, ancient Greek culture knew more ways to achieve it, like courage in battle or even superior rhetorical skills.
Misunderstanding the olympic motto
When the founder of the modern Olympic Games, Pierre de Coubertin, proposed to adopt the tricolon of “Citius – Altius – Fortius“ (latin for higher – faster – stronger) as the Olympic Motto in 1894, he didn’t have in mind the endless pursuit of new records or the comparison of merits in the medal table. As he puts it: “the importance in life is not necessarily the triumph, but the struggle”. So, rather than focusing on a need for athletes to conquer ever-growing heights, he wanted to celebrate the efforts of the many, who would never bask in the light of an Olympic medal.
But for the public eye, this interpretation of the Olympic Motto has always carried less weight. Especially in the media, it rather translates into a binary logic of success or defeat. Either someone manages to be higher, faster or stronger than everybody else; or is essentially one of many defeated. Also, the excessive focus on athletes being “Champions” or otherwise remaining “incomplete”, whenever they don’t manage to win an important competition, stands in detriment to Coubertins interpretation of the phrase.
One of the feel-good stories of the Olympics was high jumpers Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim voluntarily sharing the gold medal, while showing there can be room for more than one champion. While the focus usually lays so heavily on which individual athlete will reign supreme above everyone else, for many this was a welcome change. Even though this will probably not be a regular occurrence in the future, there was a novelty to it: it didn’t take anything away from the athletes’ extraordinary feats not to require one of them to be defeated in the end. Of course, yielding winners and losers will stay an inherent characteristic of athletic competition, a fact that brings its own challenges.
The burden of perfection
Without a doubt, the pressure that comes with constantly having to perform at the highest level takes a toll on athletes. Michael Phelps, swimmer and 23-time recipient of an Olympic gold medal, released his documentary “The Weight of Gold” in 2020 and has spoken openly about his struggles with depression and suicidal thoughts. He retired after the 2016 Olympics, but his objections towards treating athletes as “products until they stop competing” rang truer than ever in Tokyo. The unique challenge of having to prepare for the games in a year where very little competition was possible and being forced to isolate from most of their support systems, put athletes in a very fragile position both physically and mentally.
Someone who was the least expected to prove Phelps’ point was Simone Biles, even more than Phelps, an absolute phenomenon and the megastar of her sport: artistic gymnastics. Biles has won countless medals at world championships and Olympic Games at the age of 24 and is known for mastering the most difficult elements, even having new artistic elements named after her. In Tokyo, she was expected to compete – and essentially also win – in six different events.
But after an uncharacteristically shaky performance in the team competition, Biles left the gym and spent the rest of the evening cheering on her team from the sidelines. Contrary to what most pundits believed to be the case, Biles later spoke about how no physical injury, but rather her struggles with mental health, caused her to pull out of the competition. The reaction from athletes at the Olympics alone showed the magnitude of someone under so much pressure to win talking about what staggering expectations do to them: Biles received overwhelming support from many who before were too scared to speak out.
Far more scary than the fact Biles was struggling is that we have come to expect flawlessness from athletes. When they succeed, no superlative is big enough, no metaphor is too daring in describing their herculean endeavors. The pitfalls of that are obvious: whenever an athlete doesn’t live up to the perfection, they have essentially failed, leaving little room for a healthy perspective on their performance. That an athlete as famous for perfecting her craft as Simone Biles normalizes having troubles with that, is a big step forward. Since there are many people who see athletes as role models, being okay only when being flawless should not be a lesson that is taught. Biles took an important leap of faith for making progress in that regard.
So what do we make of the latest, in a sense strangest, Olympic Games in modern history? Maybe we didn’t have the roaring crowds in the stands, less of “pomp and circumstance” – maybe these games were quieter than what we are used to. But having “less” of some things also meant having more space for others. Remarkably, many athletes used this space to further challenge the world’s understanding of what is expected of them, how they should behave, and what they are allowed to say.
In the end, few believed Simone Biles would come back to participate, after having pulled out of one olympic event after the other. After all, she came back for the balance beam, the last event – once again defying expectations. Winning bronze, she said this medal meant “more than all the golds” before.
Illustrations by Maria Plasczymonka @plasticbusiness
±
Olympia: Die Bürde der Perfektion
Während ich diesen Artikel schreibe, sind die Olympischen Spiele bereits seit einem Monat Geschichte. Und trotzdem ist es schwierig auszumachen, was man von ihnen halten soll: Ein Spektakel ohne Zuschauer:innen, ausgetragen in gigantischen Stadien, die auf unheimliche Art und Weise still waren. Ohne Zweifel war dies die offensichtlichste Erinnerung daran, dass diese Spiele alles waren, nur nicht “normal”. Offenkundig fehlte das erwartungsvolle Knistern in der Luft, das sich einstellt, wenn das Olympische Feuer erleuchtet wird und die Wettkämpfe beginnen.
Das Aufschieben der Eröffnungsfeier um ein ganzes Jahr änderte nichts daran, dass wir Zeug:innen der Olympischen Spiele von “Tokio 2020” wurden - offenbar konnte sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch nicht ganz von 2020 trennen. Und ähnlich wie die vergangenen anderthalb Jahre Pandemie, die für diesen Aufschub sorgten, spülte auch die diesjährigen Spiele Themen an die Oberfläche, die zuvor lange nur darunter gebrodelt hatten.
Die Evolution von “Athlete Activism”*
(*Aktivismus, der von Athlet:innen ausgeführt wird.)
Zunächst lockerte das IOC Regel 50 der Olympischen Charta, die es Athlet:innen verbot, während der Olympischen Spiele jegliche Form sichtbaren Protests zu zeigen oder Demonstrationen zu initiieren. Im Kern wurden diese so daran gehindert, ihre Meinung zu Themen jenseits des sportlichen Wettkampfes zu äußern – durch den wachsenden Druck gab das IOC jedoch nach langer Gegenwehr schließlich doch nach.
Viele machten Gebrauch von ihren neuen Freiheiten: Fußballspieler:innen verschiedener Nationalitäten knieten vor Spielen auf dem Rasen nieder, um gegen strukturellen Rassismus zu protestieren. Kugelstoßerin Raven Saunders und Fechter Race Imboden formten ein “X” mit ihren Armen, als Zeichen für die “Kreuzung, an der sich all jene treffen, die unterdrückt werden”, wie Saunders das Symbol erklärte. Keine Frage: Politischer Protest ist schon immer Teil der Olympischen Spiele gewesen. Das berühmteste Beispiel lieferten 1968 die beiden schwarzen Leichtathleten Tommie Smith und John Carlos, die auf dem Podium stehend ihre Köpfe senkten und ihre Fäuste in die Luft streckten, um gegen soziale Ungleichheit und Rassismus zu protestieren und die schwarze Bürgerrechtsbewegung Black Panthers zu unterstützen. Nur kurze Zeit später wurden daraufhin mit dem Ausschluss von den Olympischen Spielen und einer lebenslangen Verbannung aus dem IOC bestraft. Dass friedlicher Protest nicht länger als Regelbruch angesehen wird, ist ein wichtiges Signal - auch wenn das IOC weiterhin alles andere als ein Leuchtfeuer des Kampfes für soziale Gerechtigkeit ist (“Kritik an Olympia 2022 in Peking nimmt Fahrt auf”). Dennoch, es scheint, als erhalte das Bild der Athlet:innen als eine Art stimmloses Unterhaltungsinstrument Risse.
Die Missinterpretation des olympischen Mottos
Als Pierre de Coubertin – Gründer der modernen Olympischen Spiele – 1894 vorschlug, das Trikolon “Citius – Altius –Fortius” (lateinisch für “Höher – Schneller – Weiter”) als das Olympische Motto zu adaptieren, hatte er dabei nicht die endlose Hatz nach neuen Rekorden oder den Vergleich von Erfolgen im Medaillenspiegel im Sinn. Seine Gedanken dazu spiegelten das wider: “Das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, sondern der Kampf”. Statt die schwindelerregenden Rekorde der Einzelnen zu zelebrieren, wollte er die Anstrengungen der Vielen, die niemals in den Genuss einer olympischen Medaille kommen würden, in den Fokus rücken.
Für die öffentliche Meinung hingegen hatte diese Interpretation des Olympischen Mottos schon immer weniger Gewicht. Besonders in den Medien wird Höher – Schneller – Weiter eher als binäre Logik von Erfolg oder Scheitern verstanden. Entweder schafft es jemand, alle anderen zu übertreffen – oder ist im Grunde eine:r von vielen Besiegten. Auch der exzessive Fokus darauf, dass Athlet:innen zwingend siegreich sein müssen, um nicht als “unvollendet” abgestempelt zu werden, steht im direkten Gegensatz zu den von Coubertin formulierten Idealen.
Eine der Feelgood-Stories der diesjährigen Olympischen Spiele erzählten die Hochspringer Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim, die sich freiwillig dazu entschlossen, die Goldmedaille zu teilen und damit bewiesen, dass es genug Raum gibt für mehr als einen Sieger. Während der Fokus normalerweise darauf liegt, welche:r Individualist:in allen anderen überlegen ist, war dies eine willkommene Abwechslung. Und auch, wenn es wahrscheinlich eine einmalige Geschichte bleibt, lässt sich daraus lernen: Das Teilen der Medaille schmälerte in keiner Weise die unglaublichen Leistungen der Athlet:innen und dies anzuerkennen erforderte nicht, den einen gewinnen und den anderen verlieren zu sehen. Dass Sieger:innen und Verlierer:innen gewiss auch in Zukunft zur DNA des Wettkampfsports gehören werden, bringt allerdings ganz eigene Herausforderungen mit sich.
Die Bürde der Perfektion
Zweifelsohne fordert der Druck, ständig Höchstleistungen erbringen zu müssen, seinen Tribut von Spitzensportler:innen. Michael Phelps, Schwimmer und 23-facher Träger einer olympischen Goldmedaille, veröffentlichte 2020 seinen Dokumentarfilm “The Weight of Gold” und sprach offen über seinen Kampf mit Depressionen und Selbstmordgedanken. Nach den Olympischen Spielen 2016 beendete er seine Karriere, aber sein Protest gegen die Behandlung von Athlet:innen als “Produkte, bis sie aufhören, an Wettkämpfen teilzunehmen”, war in Tokio präsenter denn je. Die einzigartige Herausforderung, sich in einem Jahr, in dem nur wenige Wettkämpfe ausgetragen wurden, auf die Spiele vorzubereiten und sich gleichzeitig stark sozial isolieren zu müssen, brachte die Athlet:innen sowohl körperlich, als auch mental an ihre Grenzen.
Eine, von der man am wenigsten erwartet hätte, dass sie die These von Phelps bestätigen würde, ist Simone Biles – mehr noch, da Biles ein absolutes Phänomen in ihrer Sportart, dem Kunstturnen, ist. Biles hat mit ihren 24 Jahren bereits unzählige Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen und ist dafür bekannt, dass sie auch die schwierigsten Elemente beherrscht. Nach ihr wurden sogar neue artistische Elemente benannt. In Tokio erwartete man von ihr, dass sie in sechs verschiedenen Disziplinen antreten würde – und nicht nur das: Eigentlich erwartete man auch, dass sie in allen ganz oben auf dem Treppchen stünde.
Doch nach einer für sie untypisch wackeligen Leistung im Teamwettbewerb verließ Biles die Halle und verbrachte den Rest des Abends damit, ihr Team von der Seitenlinie anzufeuern. Im Gegensatz zu den Annahmen der Expert:innen, sprach Biles später darüber, dass keine körperliche Verletzung, sondern ihre mentale Gesundheit der Grund für den Rückzug aus dem Wettbewerb sei. Allein die Reaktionen anderer Athlet:innen zeigten, wie groß der Erfolgsdruck ist – Biles erhielt überwältigende Unterstützung von vielen, die zuvor zu viel Angst gehabt hatten, die eigenen Probleme öffentlich zu machen.
Viel erschreckender, als dass Biles zu kämpfen hatte, ist die Tatsache, dass wir von Sportler:innen Makellosigkeit erwarten. Wenn sie erfolgreich sind, ist kein Superlativ groß genug, keine Metapher zu gewagt, um ihre herkulischen Anstrengungen zu beschreiben. Die Fallhöhe, die sich daraus ergibt, liegt auf der Hand: Wann immer ein:e Sportler:in der Erwartung nach Perfektion nicht gerecht wird, hat er oder sie im Grunde genommen versagt. Das lässt wenig Raum für eine gesunde Sichtweise auf ihre Leistung. Dass eine Sportlerin wie Simone Biles, die berühmt dafür ist, ihr Handwerk perfekt zu beherrschen, ihre Schwierigkeiten mit diesem System kundtut und normalisiert, ist ein großer Schritt nach vorn. Da nach wie vor viele Menschen Athlet:innen als Vorbilder sehen, ist man mit der Erwartung von Perfektion mindestens schlecht beraten. Biles hat auch in dieser Hinsicht für Fortschritt gesorgt.
Was lernen wir also aus den letzten, in gewisser Weise seltsamsten Olympischen Spielen der neueren Geschichte? Vielleicht gab es keine tosenden Massen auf den Tribünen, weniger “Pomp und Circumstance” – vielleicht waren diese Spiele ruhiger als wir es gewohnt sind. Aber “weniger” bedeutete in vielerlei Hinsicht auch mehr Raum für neue Impulse. Bemerkenswerterweise nutzten viele Athlet:innen diesen Raum, um das Verständnis der Welt davon, was von ihnen erwarten wird, wie sie sich verhalten sollen und was sie sagen dürfen, weiter zu hinterfragen.
Am Ende glaubten nur wenige, dass Simone Biles zurückkehren würde, nachdem sie ein Wettkampf nach dem anderen abgesagt hatte. Für den Schwebebalken jedoch – die letzte Disziplin – kam sie zurück und brach mit dem Gewinn der Bronzemedaille erneut alle Erwartungen. Diese Medaille, sagte sie danach, bedeute ihr “mehr als all die Goldmedaillen” zuvor.
Illustrationen von Maria Plasczymonka @plasticbusiness